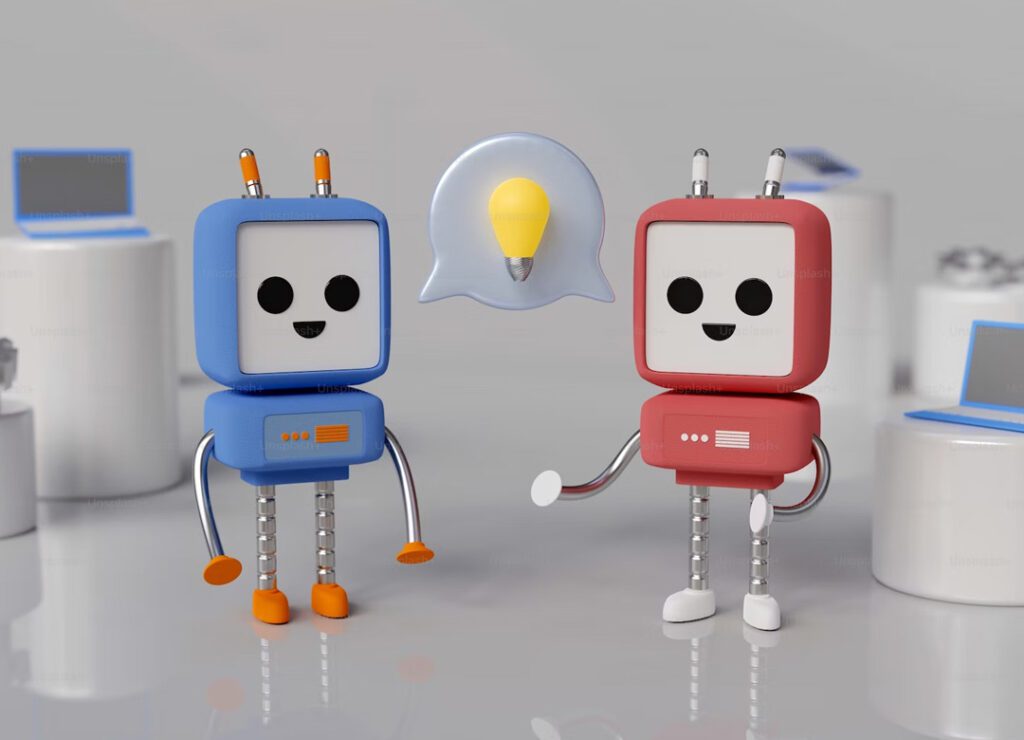Gastbeitrag von Chris Henkel, freier Autor und Journalist.
Auf dem Arbeitsmarkt hat längst eine neue Generation die Bühne betreten. Sie werden als Millennials und Generation Z bezeichnet und eines ihrer Mantras heißt: Arbeiten, um zu leben, statt leben, um zu arbeiten. Im Klartext bedeutet das nichts anderes, als dass Tätigkeiten gegen Bezahlung immer öfter außerhalb des herkömmlichen Büros ausgeübt werden. Was ist Remote Work? Einen Job zu machen, acht Stunden am Schreibtisch zu sitzen und am Ende des Tages nach Hause zu gehen, das ist längst nicht mehr die Norm und wird es immer weniger sein.Modeerscheinung oder doch die Zukunft?
Möglich macht das vor allem die sich in rasantem Tempo entwickelnde Kommunikations-Technologie. Skype, Zoom und andere Programme ermöglichen es – eine leistungsfähige Internetverbindung und die ständige Verfügbarkeit aller notwendigen Daten vorausgesetzt – eigentlich zu jeder Zeit und von jedem Ort aus zu arbeiten. Das gilt (noch) nicht für alle Wirtschaftszweige, aber für jene, die in der Kommunikations- und Informationsbranche arbeiten in jedem Fall. Die vier Schlagworte der oft beschworenen Arbeitswelt 4.0 heißen Volatilität, Unbestimmtheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Und dabei geht es im Kern vor allem darum, dass hochwertige Arbeit geleistet wird, ohne dass dabei die Art und Weise, wie das Ergebnis zustande kommt über eine tatsächliche physische Anwesenheit kontrolliert werden kann und muss. Der Vorteil der Unternehmen liegt dabei vor allem darin, dass ein 24-Stunden-Sieben-Tage die Woche-Rhythmus möglich wird. Ein Unternehmen muss keine Geschäftsadresse mieten in Frankfurt, London oder Tokio. Globalisierte Märkte und die Umstellung auf flexible Arbeitsregelungen schaffen quasi einen ganztägigen Arbeitszyklus. Nachtschwärmer und Spätaufsteher werden in der zweiten und dritten Schicht arbeiten, Morgenmenschen und traditionelle Arbeiter in der ersten und zweiten Schicht bleiben. Und da jeder in der Lage ist, zu bevorzugten Zeiten tätig zu werden, kann ein Unternehmen vernünftigerweise zu jeder Zeit mit einer Art Betrieb rechnen – ohne sich die Kosten für die Offenhaltung eines physischen Büros leisten zu müssen. Das ermöglicht es einen Großteil der Arbeit- oder Auftragnehmer Teil eines Lifestyle-Trends zu sein, der seit geraumer Zeit mit dem Begriff „Digital Nomads“ umschrieben ist. „Digital Nomads“ leben ohne festen Wohnsitz oder in weit entfernten Ländern und Städten und üben dennoch seriöse Jobs in seriösen Unternehmen aus. Das, was man auch als „Remote-Work“, also „Arbeiten aus der Ferne“ bezeichnet, ist allerdings längst nicht nur ein ferner Lebensentwurf der Millennials und der Generation Z, sondern durch das Internet auch schon seit etwa zwanzig Jahren möglich.
Bin ich selbst ein digitaler Nomade?
Ich selbst bin jetzt 48 Jahre alt und seit zehn Jahren würde ich mich, wenn es denn jemand verlangt als „Digital Nomad“ bezeichnen. Wann entscheidet man sich die Leinen zu alten Rollenbildern der Arbeitswelt zu lösen? Wie weit kann man sich entfernen? Wie kann man sich das finanziell leisten? Was bedeutet das für mein soziales Leben quasi keine Arbeitskollegen zu haben? Und wann ist es Zeit auch in der Arbeit wieder „seßhaft“ zu werden? Der Ausflug in meine eigene Arbeitsbiografie gibt darauf möglicherweise ein paar Antworten: Meine allererste Erfahrung mit dem, was man heute möglicherweise als „Remote Work“ bezeichnet, machte ich in den Jahren 2007 und 2008. Kurz bevor sich der Stuttgarter Verleger Stefan von Holtzbrinck 2009 von der Düsseldorfer Verlagsgruppe der renommiertesten Wirtschaftstageszeitung in deutscher Sprache, dem „Handelsblatt“ trennte, war dort 2007 die Sportseite „outgesourct“ worden. Und zwar nach Berlin, in die Hände eines Medien-Start-Ups. Typisch „arm aber sexy“ wurden die täglichen Sportnachrichten und -reportagen nun in einer ehemaligen Schlosserei im Souterrain eines heruntergekommenen Industriebaus in der Kastanienallee produziert. Statt der Einrichtung eines schicken Großraumbüros standen dort zwei gebrauchte Schreibtische – und sonst nichts. Zwar musste wenigstens von einem „CvD“ (Chef vom Dienst) die klassische Redaktionsarbeit gemacht und damit auch die festgelegten Arbeitszeiten von 9 bis 17 Uhr eingehalten werden. Aber „feste“ Freelancer wie ich konnten, bei einem, für deutsche Verhältnisse großzügigem Zeilen-Honorar ganz ihrer Reiselust frönen und über die neuen Kommunikationsmittel wie Skype trotzdem permanent in Kontakt zur Redaktion stehen. Im Ergebnis stand eine der besten Sportseiten der Republik, der nur deswegen keine längere Lebenszeit geschenkt war, weil die Finanzkrise, die auch die Zeitungen mit voller Breitseite erwischte, den Verlag dazu bewog, sich von dieser Rubrik endgültig zu verabschieden.Remote geht es immer irgendwie weiter
Mein Fall aus dieser Komfort-Zone war weich und ließ mich im Ergebnis eigentlich noch weiter in die Welt des digitalen Nomadentums geraten. Schon vorher hatte ich, weil mir das nach einem Handelsblatt-Artikel über die World Series of Poker in Las Vegas angeboten worden war, regelmäßig Artikel für eine Fach- und Lifestyle-Zeitschrift für Poker geschrieben. Das in Dänemark herausgegebene „ACE-Magazine“ war in Skandinavien fest etabliert und wurde auch in deutscher Sprache, mit für Deutschland, Österreich und die Schweiz spezifischen Inhalten produziert. Irgendwann wurde dort ein neuer Chefredakteur gesucht und mich erreichte eine entsprechende Anfrage – per Telefon. Ein Lifestyle-Magazin im Stile des „Playboy“ zu produzieren, mit üppigem Budget und einem „skandinavischen“ Honorar – im sich ankündigenden Zeitungs- und Zeitschriftensterben eine vielleicht „letzte“ Chance. Ich nahm an. Und machte gleich von Anfang an die Erfahrung, was „Remote Work“ wirklich heißt. Herausgeber und Layouter saßen in Kopenhagen, Sales Management und Online-Redaktion in Wien. Und die Organisation der deutschen Ausgabe ab sofort in Berlin. Spätestens zwei Wochen vor Redaktionsschluss begannen die Drähte zwischen Kopenhagen, Wien und Berlin im wahrsten Sinne des Wortes an zu glühen. Tägliche Redaktionskonferenzen, der Austausch von Verträgen, Dateien, Fotos und Texten sowie die komplette Organisation der zahlreichen Reisen zu den Events der großen internationalen Pokerturnierserien wurden über Skype abgewickelt. Gerade die letzten Tage vor Redaktionsschluss saß ich in meiner Berliner Küche und konferierte über ständige Skype-Telefonie mit meinem Layouter in Kopenhagen und gab der aktuellen Ausgabe den letzten Schliff. Oftmals saß ich selbst in irgendwelchen Presseräumen zwischen Monte Carlo und Las Vegas und orchestrierte von dort bis zum Redaktionsschluss. Eine der letzten Ausgaben wurde auf einem Interkontinentalflug nach Singapur fertiggestellt. Berlin war zu diesem Zeitpunkt nicht viel mehr für mich als eine Home Base, in der der Inhalt meiner Reisetasche ausgetauscht wurde.
Flexibel reagieren ohne festgelegte Strukturen
Doch auch mit dem Poker-Magazin war irgendwann Schluss. Der Shutdown einer der großen Online-Poker-Anbieter durch die amerikanische Regierung hatte das gesamte Business in den Abgrund gezogen. Aufgrund fehlender Einnahmen durch Anzeigen verschwanden in der Folge zumindest alle Print-Produkte vom Markt. Für mich selbst ging es innerhalb der Pokerszene dennoch auf weit niedrigerem Niveau noch ein bisschen weiter. Online Seiten mit Poker-Content machten nach wie vor Profit und so gab es weiterhin eine Nachfrage für Text- und Video-Content. Ich blieb also auf Achse. Schrieb Artikel und Reports von Hotelzimmern aus der ganzen Welt, konferierte mit Auftraggebern und Interviewpartnern über Skype und andere Kommunikationskanäle und schlief nur äußerst selten in meinem Bett in Berlin. Irgendwann erreichte mich dann das Angebot eine feste Arbeitsstelle auf Malta anzunehmen. Zwar weit weg, aber eben nicht „Remote“ genug. Denn dort hätte ich hinziehen und täglich meine acht Stunden in einem Büro sitzen müssen. Vom digitalen Nomadentum wäre wenig übriggeblieben. Für mich keine reizvolle Vision.Arbeit und Leben zusammen im Fluss
Irgendwann war es dann ganz vorbei mit dem Poker. Auch ein Immobilien-Start-Up im Bereich „Zwangsversteigerungen“, an dem ich mich beteiligt hatte, wollte nicht in die Gänge kommen. Und so zog es mich Anfang 2017 nach Minsk. Frei nach Kevin Costner, wollte ich „den Osten nochmal kennenlernen, bevor es ihn nicht mehr gibt“. Ich hatte genügend Geld, um dort ohne Einkommen ein Jahr zu überleben und genug Erfahrung als Digital Nomade gemacht, um mir auch einen weitergehenden Aufenthalt finanziell zuzutrauen. Wirklich offiziell journalistisch arbeiten war in Ermangelung einer Arbeitserlaubnis (in dem Falle einer Akkreditierung als Journalist) zwar nicht möglich, aber es eröffneten sich über diverse persönliche Kontakte eben regelmäßig andere Möglichkeiten gegen Honorar Texte zu erstellen. Ohne wirklich darauf angewiesen zu sein, fing ich bereits Mitte 2017 damit an über Webseiten wie content.de oder textbroker.de Gebrauchstexte zu verfassen. Das Honorar dafür war kaum der Rede wert, trotzdem kamen über diese Jobs immer wieder Kontakte zu Auftraggebern zustande, die Werbe- oder PR-Texte brauchten und diese auch gut bezahlten. Im Laufe der Zeit füllte ich regelmäßig das Lifestyle-Magazin eines Online-Dessous-Anbieters, schrieb eine Abschlussarbeit zum Thema Filmwissenschaft, verfasste eine in Auftrag gegebene Biografie und übernahm das monatliche Media-Monitoring für die Länder Russland, Ukraine und Belarus im Rahmen eines Fußball-Fan-Projektes, welches vom Auswärtigen Amt finanziert wurde. Meine Auftraggeber kamen dabei allesamt aus dem deutschsprachigen Raum, obwohl ich zwischendurch auch englischsprachige Texte verfasste, bei denen allerdings die Endbearbeitung eines Muttersprachlers notwendig war. Hinsichtlich der Honorare hatte ich zweifellos den Vorteil, dass ich in einem Land in Europa lebte, in dem die Preise für Miete, Essen und diverses andere weit niedriger liegen, als in Deutschland oder anderen westeuropäischen Ländern. Mir entgegen kam außerdem, dass mit einer Zeitdifferenz von zwei Stunden ich oftmals einfach mehr Tageszeit zur Verfügung habe, als wenn ich die Arbeit Zuhause erledigen würde.
Berlin – Kopenhagen – Minsk – Burgstädt
In den Sommern meiner Minsker Jahre war ich zweimal in Russland unterwegs und arbeitete – diesmal mit Akkreditierung – während des Confederations Cup und der Fußball-WM, lief den Jakobsweg und berichtetet von vor Ort von der Rugby-WM in Japan. Immer hatte ich meinen Laptop dabei und schrieb Texte, aus Zügen, Hotelzimmern und von jedem anderen erdenklichen Ort. Langsam zieht es mich allerdings auch wieder zurück in meine sächsische Heimat. Große Änderungen meines Lebens- und Arbeitsstils erwarte ich deshalb trotzdem nicht. Denn, ob man die Arbeit nun von Minsk, Kopenhagen oder eben einer sächsischen Kleinstadt aus macht, ist nach den Möglichkeiten eines digitalen Nomaden egal. Das soziale Leben erleichtert eine Entscheidung zwischen diesen Städten nicht. Aber mein Berufsleben richtet sich eben nicht mehr danach, wo ich eine richtige Arbeit für mich finde, sondern wo ich das richtige Leben für mich finde. Arbeiten lässt sich – dank Remote Work – von überall.
Chris Henkel
Chris ist freier Autor und Journalist. Seit vielen Jahren ist er in der Welt unterwegs, seine Arbeit reist ihm dabei immer hinterher.